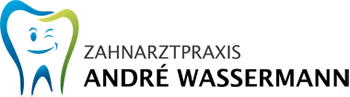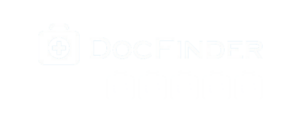Aspartam – wie gefährlich ist der Süßstoff wirklich?
Künstliche Süßstoffe sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil vieler Lebensmittel und Getränke. Besonders Aspartam (E951) ist in Light-Limonaden, zuckerfreien Kaugummis oder Diätprodukten weit verbreitet. Gleichzeitig kursieren immer wieder Schlagzeilen über mögliche Gesundheitsrisiken. Doch wie gefährlich ist Aspartam tatsächlich – und müssen wir uns Sorgen machen, wenn wir regelmäßig Getränke mit diesem Süßstoff konsumieren?
Was ist Aspartam?
Aspartam ist ein synthetischer Süßstoff, der etwa 200-mal süßer schmeckt als Zucker. Chemisch besteht er aus zwei Aminosäuren (Asparaginsäure und Phenylalanin) sowie einer geringen Menge Methanol, die beim Abbau im Körper entsteht. Diese Bestandteile kommen auch in vielen natürlichen Lebensmitteln vor, allerdings in anderer Zusammensetzung und Konzentration.
Sicherheitseinschätzungen durch Behörden
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) haben Aspartam mehrfach umfassend bewertet. Ergebnis: Bei Einhaltung der sogenannten ADI-Grenze (Acceptable Daily Intake) gilt Aspartam als sicher. Der ADI-Wert liegt bei 40 mg pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Für eine erwachsene Person mit 70 kg Körpergewicht entspricht das einer Menge, die in etwa 14 Dosen Light-Limonade enthalten wäre – täglich, über längere Zeit. Für die allermeisten Konsumenten ist dieser Wert im Alltag kaum erreichbar.
Diskussion um mögliche Risiken
Trotz dieser Einschätzungen gibt es immer wieder Diskussionen:
- Krebsrisiko: Die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) der WHO stufte Aspartam 2023 als „möglicherweise krebserregend“ (Gruppe 2B) ein. Diese Einstufung bedeutet nicht, dass Aspartam Krebs verursacht, sondern dass es Hinweise aus einzelnen Studien gibt, die weiteren Forschungsbedarf nahelegen. Die EFSA betont gleichzeitig, dass die bisherige Datenlage keinen Anlass gibt, den ADI-Wert zu ändern.
- Neurologische Effekte: Kritiker verweisen auf mögliche Zusammenhänge mit Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen. Bisher konnten diese Effekte jedoch wissenschaftlich nicht eindeutig belegt werden.
- Methanol und Formaldehyd: Beim Abbau von Aspartam entsteht Methanol, das im Körper zu Formaldehyd weiterverarbeitet wird. Diese Mengen sind jedoch sehr gering und liegen deutlich unterhalb der Belastung, die wir beispielsweise durch Obst oder Gemüse aufnehmen.
Aspartam und Zahngesundheit
Für die Zahnmedizin ist besonders interessant: Aspartam ist nicht kariogen. Das bedeutet, es wird von den Bakterien im Mund nicht zu Säuren abgebaut, die den Zahnschmelz angreifen. Studien zeigen, dass Aspartam im Gegensatz zu Zucker den pH-Wert im Mund kaum verändert und somit nicht zur Kariesentstehung beiträgt.
Damit kann Aspartam – wie auch andere Süßstoffe – helfen, den Zuckerkonsum zu reduzieren, was wiederum ein entscheidender Faktor für die Kariesprävention ist. Allerdings ersetzt Aspartam keine gute Mundhygiene: Regelmäßiges Zähneputzen und Fluorid bleiben die Basis für gesunde Zähne.
Für wen ist Vorsicht geboten?
Eine Ausnahme bilden Menschen mit Phenylketonurie (PKU), einer seltenen Stoffwechselerkrankung. Sie können Phenylalanin nicht abbauen und müssen Aspartam strikt meiden. Für alle anderen gilt: Aspartam ist in den zugelassenen Mengen unbedenklich.
Fazit: Müssen wir uns Sorgen machen?
Die wissenschaftliche Datenlage zeigt:
- Aspartam ist bei normalem Konsum sicher.
- Es verursacht keine Karies und kann sogar helfen, Zucker zu reduzieren.
- Einzelne Studien deuten auf mögliche Risiken hin, weshalb weitere Forschung sinnvoll ist.
- Wer Light-Getränke in moderaten Mengen konsumiert, muss sich keine ernsthaften Sorgen machen.
Wie bei vielen Dingen im Leben gilt auch hier: Die Dosis macht das Gift. Wer Aspartam-haltige Getränke genießt, sollte dies bewusst und in Maßen tun – und gleichzeitig auf eine insgesamt ausgewogene Ernährung achten.
Kurz gesagt: Aspartam ist kein „Wundermittel“, aber auch kein „Gift“. Für die Zahngesundheit ist es deutlich besser als Zucker, und gesundheitliche Risiken sind bei normalem Konsum nach aktuellem Stand der Wissenschaft nicht zu erwarten.