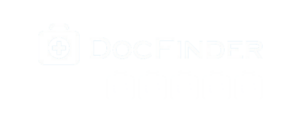Fluorid: Fluch oder Segen?
Über die Verwendung von fluoridhaltigen Zahnpasten wird viel diskutiert. In den Medien wird häufig über Fluorids Schutzwirkung vor Karies berichtet, obwohl einige behaupten, dass Fluorid den Zähnen schadet oder sogar giftig ist. Auch ich werde in der Praxis sehr oft darauf angesprochen und möchte deshalb einige Mythen über Fluorid in diesem Artikel aufräumen und alle Fragen rund um das Thema so gut es geht klären.
Der Zahnschmelz ist das härteste Material im Körper, das wie ein mikrofeines Gitter aus Kristallfasern die Zahnoberfläche überzieht. Allerdings hat er eine Schwachstelle: Wenn zucker- oder kohlenhydrathaltige Getränke oder Speisen genossen werden, freuen sich die Bakterien im Mund. Denn dabei entstehen Säuren, die den Zahnschmelz porös machen. In den Lücken finden Bakterien ideale Nistplätze. Karies entsteht.
Fluorid schützt
Fluoride in der Zahnpasten helfen, Mineralien wie Kalziumphosphat in die Zahnoberfläche wieder einzulagern. Sie legen sich wie ein Schutzfilm um die Zähne. Nicht nur Wissenschaftler, auch Verbraucherschützer wie die Stiftung Warentest bestätigen, dass Fluoride für die Zähne ein Segen sind. Wer mit fluoridhaltiger Zahnpasta die Zähne putzt, muss deutlich weniger den Bohrer des Zahnarztes fürchten als jemand, der eine fluoridfreie Zahnpasta benutzt.
Ist Fluorid giftig?
Der Mythos, Fluorid sei giftig, hält sich hartnäckig. Fluorid ist aber im Gegensatz zu dem namensähnlichen Fluor nicht giftig oder gefährlich für den Körper. Es handelt sich um Salze, die ein wichtiges Spurenelement des menschlichen Körpers darstellen. Bei Fluoriden ist es ähnlich wie bei anderen Mineralstoffen: Werden sie zu hoch dosiert, dann können sie schaden. Deshalb ist auch die Angst, Fluoride könnten Zähne und Knochen von Kindern bröckeln lassen, nicht grundsätzlich falsch. „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht`s, dass ein Ding kein Gift sei.“ Dieser berühmte Satz von Paracelsus trifft auch hier zu. Mit Natriumfluorid ist es ebenso wie mit Natriumchlorid, unserem Kochsalz: Auch das hat mit dem Chlor im Schwimmbadwasser nicht viel zu tun und wir salzen bereitwillig unser Essen damit. Vergiftungen mit Fluorid sind jedoch nahezu unmöglich. Es müsste eine Tube Erwachsenen-Zahnpasta verzehrt werden, damit ein sechsjähriges Kind Vergiftungserscheinungen zeigt. Ein Erwachsener müsste 3 Tuben Zahnpasta auf einmal schlucken, um erste Anzeichen einer Vergiftung zu entwickeln.
Wie entsteht Karies und was macht Fluorid?
In unserem natürlichen Zahnbelag leben Bakterien. Nehmen wir Zucker zu uns, nehmen diese Bakterien ihn ebenfalls auf, verstoffwechseln ihn und produzieren Säuren. Die schädigen unsere Zähne, weil sie Mineralien aus unserem Zahnschmelz herauslösen und so die Entstehung von Karies begünstigen. Diesem Prozess kann Fluorid entgegensteuern. Unser Zahnschmelz besteht zu einem großen Teil aus Hydroxylapatit, das sehr empfindlich auf Säuren reagiert. Putzen wir uns nun mit fluoridhaltiger Zahnpasta die Zähne, dringt das Fluorid in den Zahnschmelz ein und schmeißt dafür Hydroxid-Ionen hinaus. Durch diesen Tausch entsteht an der Zahnoberfläche eine hauchdünne Schicht eines festeren, stabileren Minerals namens Fluorapatit, dem Säuren nicht mehr viel anhaben können. Haifischzähne bestehen übrigens zu fast 100 Prozent aus Fluorapatit. Das ist auch der Grund warum Haifischzähne besonders fest und widerstandsfähig sind.
Fazit: Die Studienlage ist eindeutig!
Aus über 600 internationalen Studien geht hervor, dass Fluorid einer der wesentlichen Faktoren ist, warum Karies in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen ist. Fluorid ist sehr wirksam und sehr einfach anzuwenden. Wenn viele Menschen darauf verzichten würden, könnte Karies wieder zu einer ernstzunehmenden Erkrankung werden. Grundsätzlich sollte zweimal täglich mit fluoridhaltiger altersgerechter Zahnpasta geputzt werden. Altersgerecht heißt: In Zahnpasten für Erwachsene sollten 1.000 bis 1.500 ppm Fluorid enthalten sein, in Zahnpasta für Kinder bis 6 Jahre 1.000 ppm. In der Apotheke oder im Drogeriemarkt gibt es außerdem Fluoridgele und fluoridierte Mundspüllösungen zu kaufen, die einmal wöchentlich aufgetragen werden sollen. Bitte sprechen Sie gerne mit uns darüber, ob das bei Ihnen erforderlich ist. Bei einem erhöhten Kariesrisiko kann das der Fall sein. Sogenannte „White Spots“, weiße Flecken auf den Zähnen sind unter anderem ein Zeichen für Entkalkung. Dann ist eine zusätzliche Fluoridanwendung sinnvoll. Verfärbungen auf den Zähnen können allerdings auch ein Zeichen von Fluorose sein. Die entsteht, wenn zu viel Fluorid verwendet wurde. Das ist allerdings sehr selten und ein rein ästhetisches Problem.
Vielleicht noch ein interessantes Video zum Schluss: So gefährlich ist Fluorid in Zahnpasta – die Mathematik dahinter (youtube.com)
Quellen
https://www.bfr.bund.de/cm/343/fluorid_haltige_mundwaesser_und_alkoholgehalt_in_mund__und_zahnpflegemitteln.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/343/fuer-gesunde-zaehne-fluorid-vorbeugung-bei-saeuglingen-und-kleinkindern.pdf
https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/b/fluoride.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/gzYXQn3HDLI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.prodente.de%2Fpresse%2Fschwerpunkt%2Feinzelansicht%2Fschwerpunkt%2Fpasta-mit-buerste-ja-zum-fluorid.html
https://www.zm-online.de/markt/news/detail/sieben-mythen-ueber-fluorid-auf-den-zahn-gefuehlt/
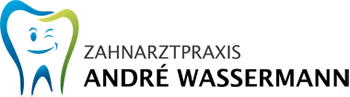
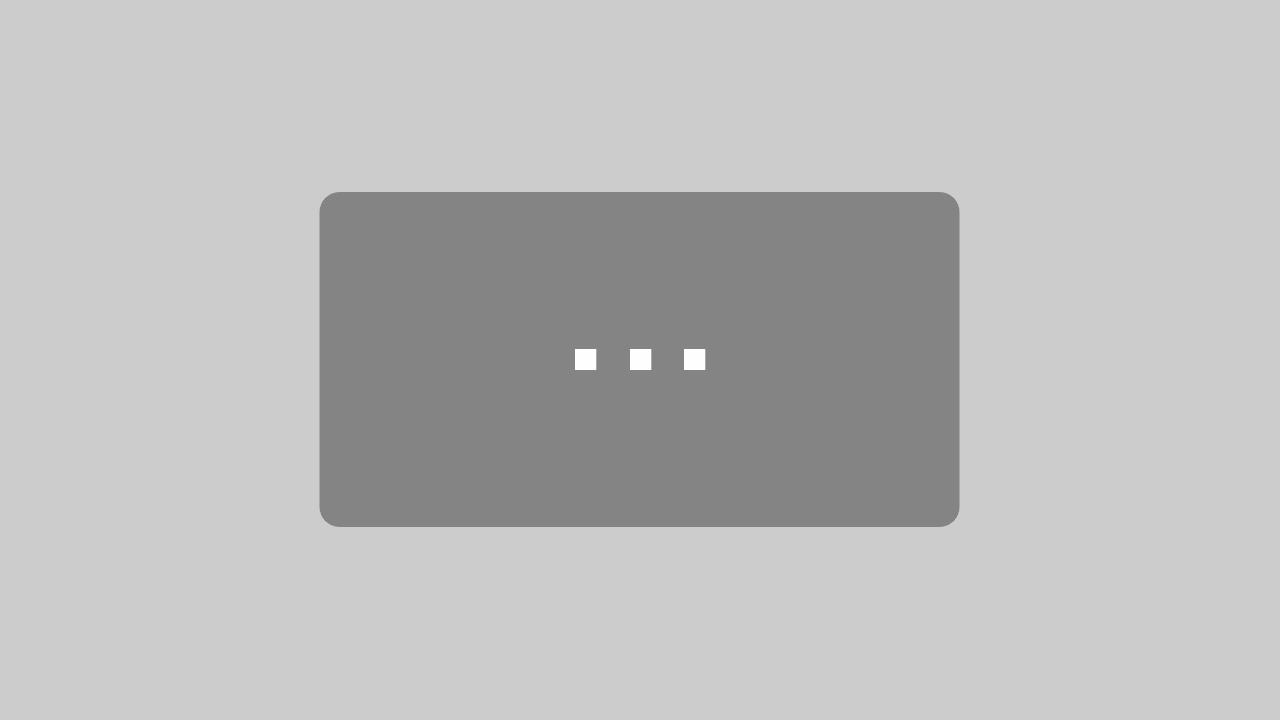
 Mit der Zahn-gesund.at App können Sie wie gewohnt unsere Web-Inhalte lesen, haben Zugriff auf unseren informativen
Mit der Zahn-gesund.at App können Sie wie gewohnt unsere Web-Inhalte lesen, haben Zugriff auf unseren informativen